Zep! Talk: Sprache steuert Zustand – und dein Nervensystem hört zu
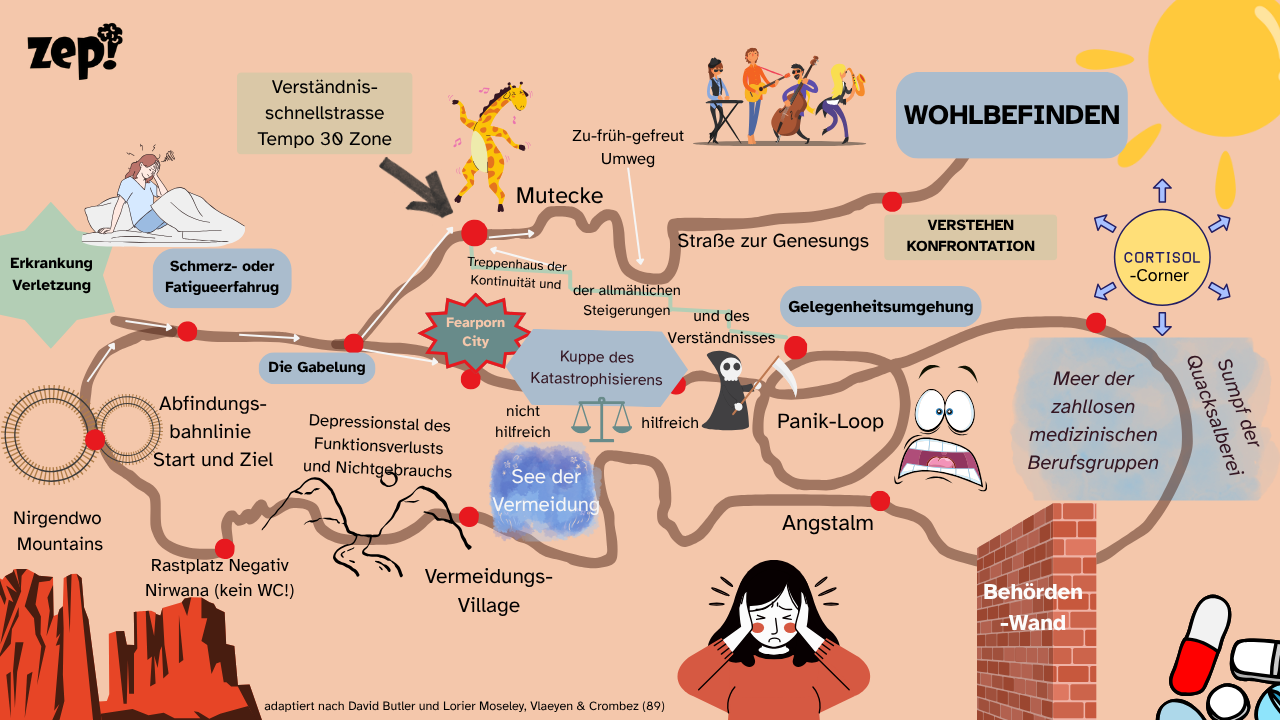
Viele Menschen mit Erschöpfung, Long Covid, ME/CFS, POTS oder Belastungsreaktionen beschreiben ihre Situation mit Sätzen wie: „Seitdem ging nichts mehr“, „Ich hoffe, dass sich etwas bessert“, „Das hat alles nichts gebracht“, „Ich war komplett hilflos“. Diese Sprache wirkt nicht nur nach außen – sie erzeugt im eigenen Nervensystem sehr konkrete Reaktionen. Das kann Probleme einerseits schneller entstehen lassen und zum Problemerhalt beitragen.
Bevor wir über Sprache, Identität und Steuerung sprechen, ist eines wichtig: Niemand behauptet, schon gar nicht ich selbst, dass Erschöpfung, Long Covid, ME/CFS oder POTS „psychisch“ seien oder keine biologische Basis hätten. Im Gegenteil – die Prozesse, über die wir sprechen, sind tief neurobiologisch verankert: Gehirnstamm, Hypothalamus, autonome Verschaltung, Immunantwort, Perfusion, Atmung, Energiestoffwechsel und sensorische Systeme sind messbar beteiligt. Aber: Diese Systeme werden nicht nur durch Infekte, Entzündung, Stoffwechsel oder Dysautonomie beeinflusst – sondern auch durch Bedeutung, Einschätzung, Handlungsspielraum und Sprache. Wer mehrere Ebenen gleichzeitig adressiert, hat deutlich bessere Chancen, wieder zu regulieren. Es geht nicht darum, ob etwas „echt“ ist, sondern darum, welche Stellschrauben wir nutzen, damit das Nervensystem wieder Anpassung und Erholung zulässt. Und Sprache ist eine davon.
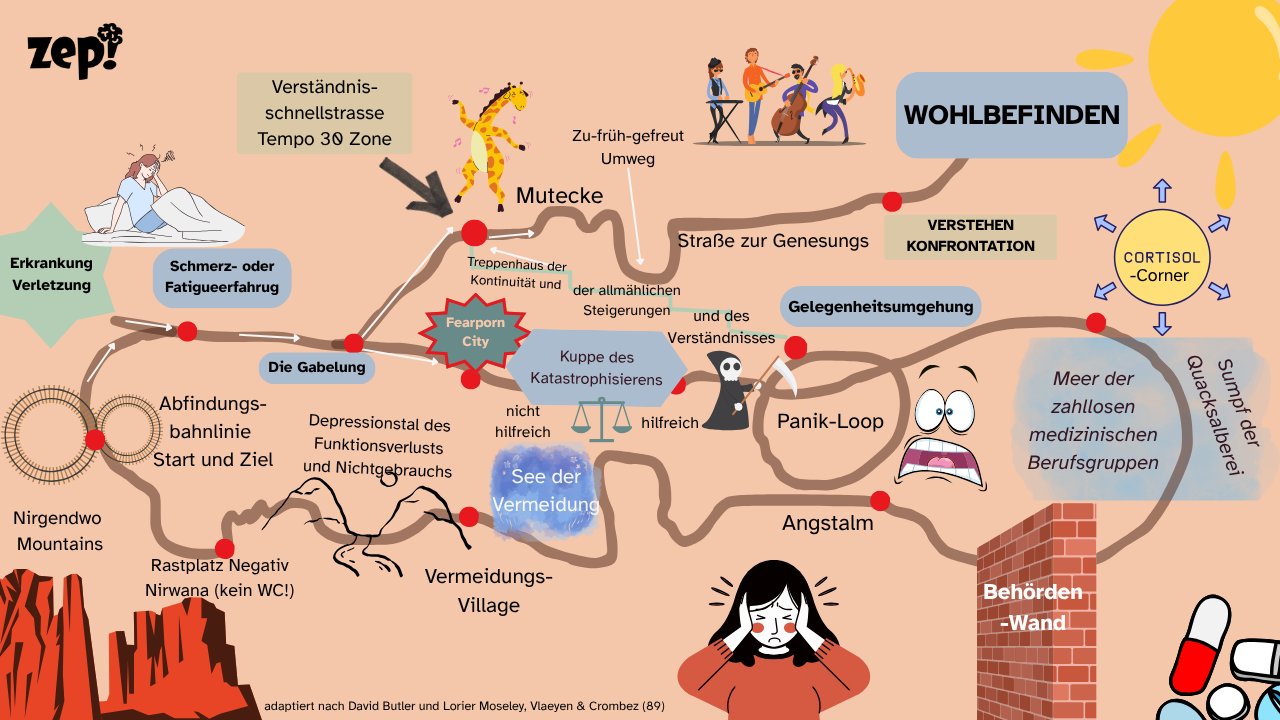
Warum das nicht psychologisch ist, sondern Neurobiologie
Im Gehirn gibt es einen Bereich, der Bedeutungen zuordnet und bewertet, ob etwas beeinflussbar ist: der mediale präfrontale Cortex (mPFC). Immer wenn du etwas denkst, sagst oder beschreibst, entscheidet dieser Bereich: Habe ich Handlungsspielraum oder nicht?
Wenn deine Worte Ohnmacht ausdrücken („Ich konnte nichts tun“), wertet der mPFC die Situation als unkontrollierbar. Diese Information wird an eine Schaltzentrale im Mittelhirn weitergegeben, das periaquäduktale Grau (PAG). Das PAG entscheidet, welchen Zustand dein Körper fährt: Schutz, Rückzug, Alarm, Abschaltung oder Anpassung.
Von dort geht die Information direkt weiter an den Hypothalamus, der den Autopiloten für Kreislauf, Immunreaktion, Schlafrhythmus, Energieverfügbarkeit, Atemregulation und Hormonachsen steuert. Wenn das System „bedrohlich, aber unkontrollierbar“ meldet, fährt der Körper automatisch Programme wie Erschöpfung, Schwindel, orthostatische Instabilität, Druckabfall, Schlaflosigkeit, Muskelkraftverlust oder Reizüberempfindlichkeit. Und das hat nichts mit Psychologie zu tun. So ist einfach die Neuroanatomie.
Kein Placebo, kein Mindset, sondern ein biologischer Ablauf.
Sprache als Trigger oder Türöffner
Begriffe wie „Crash“ (Nocebo), „Zusammenbruch“, „kaputt“, „ich funktioniere nicht mehr“ verstärken unbewusst das Schutzprogramm. Das Gehirn hört nicht den Inhalt – es hört die Bedeutung: Gefahr + keine Handlung.
Wenn du stattdessen sagst: „Mein Körper reagiert aktuell mit einer Belastungsreaktion“ oder „Bestimmte Systeme sind gerade überfordert“, entsteht ein völlig anderer interner Zustand. Der mPFC registriert: Es gibt Struktur. Damit bleibt das PAG, unser "Zustandsselektor" im Gehirn, adaptiv - und nicht nur in der defensiven passiv-coping Schaltung gefangen. Und der Hypothalamus könnte wieder regulieren, statt alles herunterzufahren.
Was statt Diagnosen-Identität wirkt
Wer sich sprachlich mit „Ich bin krank“, „Ich bin CFS-Patient“, „Ich bin Long-Covid-Betroffener“ identifiziert, erzeugt einen Rahmen, aus dem das Nervensystem nicht aussteigen darf. Identität legt fest, was möglich ist und was nicht. Diagnosen sind Labels, sie schränken ein. Das passiert nicht bewusst, sondern automatisch – Verhalten, Fähigkeiten, Erwartungen, Wahrnehmung und Körperreaktionen richten sich danach. Es geht den Menschen in der Regel nicht besser mit einer Diagnose. Ja, es mag irgendwie "beruhigend" sein, eine Diagnose zu bekommen. Aber was ändert sie, wenn sie die Handlungsoptionen nicht erweitert?
Eine funktionale Identität lautet nicht: „Ich bin gesund“ (das glaubt das System nicht), sondern:
„Ich bin jemand, der sein Nervensystem trainiert und reguliert.“
„Ich arbeite aktiv an meiner Belastungstoleranz.“
Das verschiebt Handlung, ohne zu leugnen.
Generalisierung hält das Gehirn in Alarm
Sätze wie „Es ist alles schlimmer geworden“, „Nichts hilft“ oder „Mein System ist komplett kaputt“ erzeugen im Gehirn ein Bedrohungssignal ohne Grenze. Das PAG reagiert dann nicht differenziert, sondern schaltet großflächig Schutzprogramme. Das spürt man als Kollaps, Erschöpfung, Reizüberflutung oder Kreislaufzusammenbruch.
Sobald Dinge benennbar und begrenzbar sind, kann das Gehirn neu bewerten. Beispiel:
Statt „Ich halte nichts aus“ lieber „Stehen belastet mein Herz-Kreislauf-System nach 60 Sekunden, und das kann ich trainieren.“ Damit entsteht Handlungsspielraum.
Passiv behandelt zu werden hält dich passiv
Wenn Therapie bedeutet: „Jemand macht etwas mit mir“, bleibt der mPFC in Beobachterrolle. Das PAG bleibt im Schutzmodus, weil keine Eigensteuerung aktiviert ist. Selbst kleinste aktive Reize jedoch – Atemlenkung, Blickfixation, sanfte Kopfbewegung, Druckreiz, Lichtreflex-Test – signalisieren dem Gehirn: "Ich bin beteiligt, ich mache!" Allein das verändert schon die neurologischen Kreisläufe.
Belastungsreaktionen sind keine Schicksalsschläge
Was viele „Crash“ nennen, wirkt wie ein Einbruch ohne Vorwarnung. In Wirklichkeit gibt es immer Vorzeichen: z.B. veränderte Atmung, visuelle Überforderung, sinkende Kreislaufstabilität, Lichtempfindlichkeit, Muskelspannungsverlust, Pulsanstieg, Zittern, Denkblockaden oder Schlaffragmentierung. Wenn man diese Reaktionen als Marker versteht – nicht als „Rückfall“ –, entsteht wieder Steuerbarkeit. Benennung = Zugriff - und Anpassung.
Ursache-Wirkung wird erst sichtbar, wenn man Zusammenhänge versteht
Viele glauben, ihr Körper reagiere „zufällig“ oder „unberechenbar“. In Wahrheit summieren sich Belastungen und allerlei Stressoren (z.B. Licht, Geräusche, Atemmuster, Hunger, Infekte, Allergene, Stress, Kopfbewegung, alte Narben uvm) und überschreiten irgendwann eine Grenze. Wie ein Fass, was überläuft. Wenn man versteht, welche Systeme betroffen sind, sind Regulationen plötzlich testbar – statt mysteriös.
Warum Mantren kein spirituelles Beiwerk sind
Ein Wort noch zu Mantren. Weil ich es faszinierend finde, wie sich diese jahrtausendealte Praxis heute neurobiologisch und neuroanatomisch plausibel erklären lässt: Sie wirken nicht, weil man sich „etwas einredet“, sondern weil sie einen sehr klaren Effekt haben:
Sie binden Aufmerksamkeit auf etwas, was gut für den Rezitierenden ist - und das aktiviert den mPFC - der hemmt Alarmnetzwerke und schaltet auf "active coping" also aktive Strategien - das steuert Atemrhythmus - moduliert so Vagusfunktion - was wiederum Entzündungen hemmt und Stresssignale im reduziert PAG - was letztendlich Hypothalamus-Funktionen stabilisiert.
Ein einziger wiederholter, konstruktiver Satz, laut ausgesprochen und rezitiert, kann physiologisch deutlich mehr bewirken - und vor allem deutlich mehr Positives - als Grübeln, Hoffen oder Diagnosen wiederholen. Wenn man das dann noch verbindet mit einer individuellen Trainingsstrategie, die da ansetzt, wo der Klient gerade ist, dann können tolle Dinge geschehen.
"Words - don´t come easy, to me....." (F.R.David, 1983)
Sprache ist kein Beiwerk, sondern ein Steuerungsimpuls. Jeder Satz entscheidet im Gehirn, ob dein Zustand als bedrohlich und unkontrollierbar eingestuft wird – oder als beeinflussbar. Das beeinflusst unmittelbar Kreislauf, Atmung, Spannung, Immunsystem, Wahrnehmung und Energie.
Es ist nicht leicht, automatisierte Sprachmuster zu ändern. Aber alles fängt mit Wissen an. Danach kann Bewusstsein kommen. Und wenn wir uns bewusst werden, dann können wir auch unsere Sprache und uns so uns selbst verändern.
Du musst nichts schönreden. Aber du kannst so sprechen, dass dein Nervensystem wieder regulieren darf – und genau da beginnt Veränderung.
Marc Nölke
Zep! neuro systems
Referenzen
- Ader, R., Felten, D. L., & Cohen, N. (1995). Psychoneuroimmunology (2nd ed.). Academic Press.
- Ashar, Y. K., Gordon, A., Schubiner, H., Uipi, C., Knight, K., Anderson, Z., Carlisle, J., Polusny, M., Lumley, M. A., & Wager, T. D. (2021). Effect of pain reprocessing therapy vs placebo and usual care for chronic back pain. JAMA Psychiatry, 78(7), 1–11.
- Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. Annual Review of Psychology, 59, 617–645.
- Benedetti, F. (2008). Placebo and nocebo mechanisms. Pain, 136(1–2), 3–6.
- Buhle, J. T., Silvers, J. A., Wager, T. D., López, R., Onyemekwu, C., Kober, H., Weber, J., & Ochsner, K. N. (2014). Cognitive reappraisal of emotion: A meta-analysis of human neuroimaging studies. Cerebral Cortex, 24(11), 2981–2990.
- Critchley, H. D., & Harrison, N. A. (2013). Visceral influences on brain and behavior. Neuron, 77(4), 624–638.
- Damasio, A. (2010). Self comes to mind: Constructing the conscious brain. Pantheon.
- Holzel, B. K., Lazar, S. W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, D. R., & Ott, U. (2011). How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action from a conceptual and neural perspective. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 537–559.
- Holmes, E. A., Craske, M. G., & Graybiel, A. M. (2014). Psychological treatments: A call for mental-health science. Nature, 511(7509), 287–289.
- Kleckner, I. R., Zhang, J., Touroutoglou, A., Chanes, L., Xia, C., Simmons, W. K., Quigley, K. S., Dickerson, B. C., & Barrett, L. F. (2017). Evidence for a large-scale brain system supporting allostasis and interoception in humans. Nature Human Behaviour, 1(5), 1–14.
- Lane, R. D., & Thayer, J. F. (2000). Emotion regulation and the brain: Functions, excitation, and inhibition of mediated cortical–subcortical circuits. Cognitive and Behavioral Neurology, 13(3), 171–184.
- LeDoux, J. (2012). Rethinking the emotional brain. Neuron, 73(4), 653–676.
- Liefbroer, A. I., & van de Schoot, R. (2017). Illness identity: A literature review. Journal of Psychosomatic Research, 101, 58–68.
- Lindquist, K. A., Wager, T. D., Kober, H., Bliss-Moreau, E., & Barrett, L. F. (2012). The brain basis of emotion: A meta-analytic review. Behavioral and Brain Sciences, 35(3), 121–202.
- Lutz, A., Slagter, H. A., Dunne, J. D., & Davidson, R. J. (2008). Attention regulation and monitoring in meditation. Trends in Cognitive Sciences, 12(4), 163–169.
- Mobbs, D., Marchant, J. L., Hassabis, D., Seymour, B., Tan, G., Gray, M., Petrovic, P., Dolan, R. J., & Frith, C. D. (2009). From threat to fear: The neural organization of defensive fear systems in humans. Journal of Neuroscience, 29(39), 12236–12243.
- Porges, S. W. (2007). The polyvagal perspective. Biological Psychology, 74(2), 116–143.
- Price, D. D., Finniss, D. G., & Benedetti, F. (2008). A comprehensive review of the placebo effect. Annual Review of Psychology, 59, 565–590.
- Roy, M., Shohamy, D., & Wager, T. D. (2012). Ventromedial prefrontal–subcortical systems and the generation of affective meaning. Trends in Cognitive Sciences, 16(3), 147–156.
- Satpute, A. B., & Lindquist, K. A. (2019). The default mode network's role in semantic, social, and self-related processing. Annual Review of Neuroscience, 42, 451–472.
- Thayer, J. F., & Lane, R. D. (2009). Claude Bernard and the heart–brain connection: Further elaboration of a model of neurovisceral integration. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 33(2), 81–88.
- Uddin, L. Q. (2015). Salience processing and insular cortical function and dysfunction. Nature Reviews Neuroscience, 16(1), 55–61.
- Vuilleumier, P. (2005). How brains beware: Neural mechanisms of emotional attention. Trends in Cognitive Sciences, 9(12), 585–594.
- Wager, T. D., & Atlas, L. Y. (2015). The neuroscience of placebo effects: Connecting context, learning, and health. Nature Reviews Neuroscience, 16(7), 403–418.
- Wood, W., & Rünger, D. (2016). Psychology of habit. Annual Review of Psychology, 67, 289–314.

