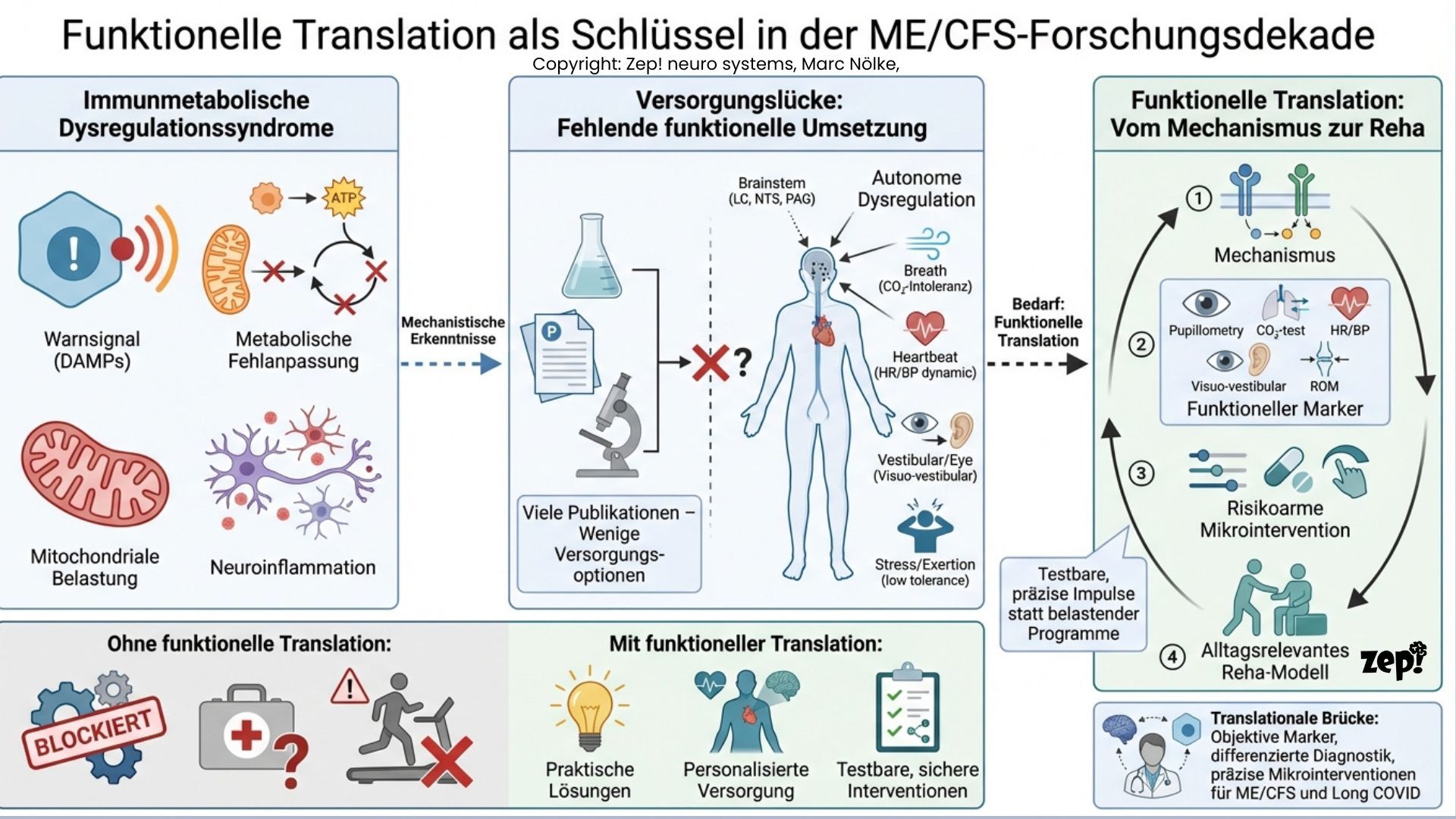1. Warum reine Mechanismenforschung nicht ausreicht
ME/CFS und Long COVID werden heute zunehmend als immunmetabolische Dysregulationssyndrome verstanden:
-
persistente Danger-Signalität (DAMPs),
-
metabolische Fehlanpassung,
-
mitochondriale Belastung,
-
neuroinflammatorische Prozesse.
Diese Erkenntnisse sind wichtig – doch ohne funktionelle Umsetzung bleiben sie für Betroffene, Ärzt:innen und Therapeut:innen kaum greifbar.
Es entstehen neue Papers, aber keine neuen Handlungsoptionen.
Damit droht der Fehler vieler Forschungsprogramme der letzten Jahrzehnte:
sehr viel Wissen, zu wenig Versorgung.
2. Die zentrale Versorgungslücke: neurovegetative Funktion
Im klinischen Alltag sind nicht Labore entscheidend, sondern funktionelle Muster:
-
autonome Dysregulation (LC, NTS, PAG)
-
CO₂-Intoleranz und Atemfehlanpassungen
-
Baroreflex-Instabilität
-
visuell-vestibuläre Überforderung
-
geringe Belastungstoleranz und schnelle Zustandsverschlechterung
Diese Muster sind nicht psychologisch, sondern neurophysiologisch erklärbar – und objektiv messbar.
Es fehlen jedoch standardisierte, risikoarme Verfahren, um diese Dysregulation systematisch sichtbar zu machen.
3. Was funktionelle Translation bedeutet
Funktionelle Translation heißt:
Mechanismus → funktionelle Marker → risikoarme Mikrointervention → Reha-Modell
Statt nur was im Immunsystem passiert, wird sichtbar, wie sich das im Alltag äußert – und was man testbasiert tun kann:
-
Pupillenmessung (LC, Parasympathikus)
-
CO₂-Tests (PAG, Atemregulation)
-
HR/BP-Dynamik (NTS, Baroreflex)
- ROM Testing
-
visuell-vestibuläre Tests (Cerebellum, LC)
Mit solchen Markern lassen sich sichere, sehr kleine, testbare Mikrointerventionen entwickeln – keine belastenden Programme, sondern präzise physiologische Reize, die unmittelbar überprüfbar sind.
4. Warum das für die Dekade unverzichtbar ist
Ohne funktionelle Translation bleiben drei Probleme bestehen:
-
Mechanismen bleiben theoretisch – nicht praktisch.
-
Versorgung bleibt unspezifisch – nicht differenziert.
-
Reha bleibt generisch – nicht neurophysiologisch.
Das heißt:
Eine rein immunologische Dekade würde wieder an der Lebensrealität der Betroffenen vorbeigehen.
Damit Forschung Wirkung entfaltet, braucht es beides:
-
Mechanistische Exzellenz (Immunologie, Metabolismus)
-
Funktionelle Operationalisierung (neurovegetative Muster & alltagsrelevante Regulation)
Diese zweite Säule ist derzeit nicht besetzt – und genau hier arbeite ich.
5. Meine Rolle in diesem Kontext
Ich arbeite translational im Grenzbereich von Neurophysiologie, Immunmetabolismus und funktioneller Rehabilitation.
Mit einem strukturierten N=1-Test–Retest-Framework mache ich neurovegetative Fehlanpassungen objektiv sichtbar und übersetze neuroimmunologische Mechanismen in sichere, alltagsnahe Mikrointerventionen.
Ich sehe meine Aufgabe darin, in der ME/CFS-Forschungsdekade eine Perspektive einzubringen, die bisher fehlt:
-
funktionelle Marker statt nur Laborwerte,
-
neurovegetative Diagnostik statt Psychologisierung,
-
präzise Reha-Tools statt unspezifischer Belastungsempfehlungen,
-
Translation statt Theorie.
Dort, wo Labor und Bildgebung an Grenzen stoßen, beginnt die funktionelle Ebene – und sie ist für ME/CFS und Long COVID zentral.
Marc Nölke, 20.11.2025